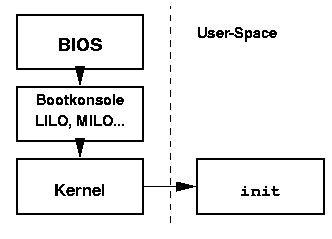
Viele Benutzer wissen heutzutage zwar, daß strenggenommen der Begriff "Linux" nur den Betriebssystem-Kern und nicht die gesamte Distribution bezeichnet, aber nur wenige haben eine Vorstellung, was hinter der Kulisse des Kernels tatsächlich passiert. In diesem Rundgang soll nicht das Fine-Tuning von SCSI-Sequenzen für Assemblerprogrammierer diskutiert werden: Vielmehr werden Benutzer, die sich bislang mehr mit der Anwendungsseite der Programmierung beschäftigt haben, grundlegende Konzepte des Betriebssystemkerns vermittelt anstatt hardwarespezifische Detailfragen zu klären. Überblicksartig wird die Aufrufschnittstelle der Systemaufrufe zum Kern betrachtet und einige zentrale Datenstrukturen von Prozessen und Treibern werden untersucht. Unter dem Gesichtspunkt des modularen Kernels wird die prinzipielle Herangehensweise bei der Implementation eines Device-Treibers erarbeitet.
Die komplett ausgepackten Kernelsourcen für die Intel-Variante1 sind nach einem Bauen eines Kernels über 33 MB groß, so daß man leicht die Übersicht verlieren kann.
Das Übersetzen eines neuen Kernels macht dem leicht fortgeschrittenen Benutzer keine Probleme mehr; selten jedoch kann man wirklich nachvollziehen, was im Betriebssystemkern eigentlich passiert -- dabei ist es ja gerade das, was Linux von anderen Betriebssystemen unterscheidet: Der Code ist frei erhältlich, kann eingesehen und sogar verändert werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht vonnöten, daß jeder einzelne Benutzer alle Details jeder Komponente kennt und versteht: Dazu gibt es schließlich eine weltweite Gemeinschaft von Entwicklern, die sich darum kümmern [7]. Im Credits-File der Version 2.0.33 stehen gegenwärtig 200 Personen aufgelistet.
Nichtsdestotrotz kann es sinnvoll sein, einen gewissen Überblick über die Zusammenhänge im Linux-Kern zu haben: Sei es, weil man einen Bug vermutet und suchen möchte, weil man ein noch nicht vorhandenes Feature hinzufügen möchte oder rein aus Neugierde2.
In diesem Artikel möchte ich mehrere Einzelaspekte des Linux-Kerns beleuchten, ohne jedoch zu sehr in die ,,gory details`` der Implementation zu gehen, dafür aber einzelne Konzepte beispielhaft beleuchten. Einige der vorgestellten Konzepte sind disjunkt, andere haben Überschneidungen oder fügen sich zu einem einheitlichen ganzen.
Die Sourcen des Linux-Kerns werden üblicherweise unterhalb des Pfades von /usr/src/linux gefunden, was wiederum üblicherweise ein symbolischer Link auf ein spezielles Verzeichnis mit der Verisonsnummer des Kerns ist. Alle Pfade in diesem Artikel beziehen sich zunächst auf diesen Präfix.
Abbildung 1 zeigt einen gekürzten Auszug aus der Verzeichnisstruktur der Quelltexte.
Abbildung 1:
Verzeichnisstruktur der Linux-Quellen
/usr/src/linux |-- Documentation |-- arch | |-- alpha | | | ... | | `-- mm | |-- i386 | | |-- boot | | | |-- compressed | | | `-- tools | | |-- kernel | | |-- lib | | |-- math-emu | | `-- mm | |-- m68k | |-- mips | |-- ppc | `-- sparc |-- drivers | |-- block | |-- cdrom | |-- char | | `-- ftape | |-- isdn | |-- net | |-- pci | |-- sbus | | `-- char | |-- scsi | | `-- aic7xxx | `-- sound | `-- lowlevel |-- fs | |-- affs, autofs, ext, ext2, | |-- fat, hpfs, nfs, ... | `-- xiafs |-- include | |-- asm -> asm-i386 | |-- asm-alpha | | ... | |-- asm-i386 | | `-- asm | | -> /usr/src/linux/include/asm |-- init |-- ipc |-- kernel |-- lib |-- mm |-- modules |-- net `-- scripts
Auf oberster Ebene kann man die Dateien in drei Klassen einteilen: Hilfsdateien (die GNU General Public License, READMEs, das Documentation-Verzeichnis, diverse Skripte zum Konfigurieren und Übersetzen), architekturunabhängige und architekturabhängige Teile des Kerns.
Der in Tabelle 1 aufgeführte Umfang der Quelltexte macht klar, daß Gliederungsstrukturen nötig sind, um eine solche Menge an Code noch handhaben zu können.
|
Ein großer Vorteil des Linux-Kerns liegt in seiner weiten Portierbarkeit. Nur wenige andere Betriebssysteme mit der gleichen Produktivität sind auf so vielen auch strukturell unterschiedlichen Plattformen übersetzbar.
Große Teile des Codes sind daher plattformunabhängig. Dies betrifft besonders Teile des Kerns, die virtualisierbar sind, d.h. wo man eine geeignete Abstraktion von der konkreten Hardware ohne allzu große Performanceeinbußen machen kann. Dies betrifft vor allem
Da diese Teile des Linux-Kerns die wichtigsten Systemfunktionen realisieren wollen wir uns in diesem Artikel hauptsächlich auf die plattformunabhängigen Eigenschaften konzentrieren.
Besonders wenn der direkte Kontakt zur Hardware notwendig ist, muß oft architekturabhängig programmiert werden. Seitdem jedoch auch zaghafte Versuche seitens der Hersteller gemacht werden, Schnittstellen auch für Hardware zu normieren, geht der Anteil architekturabhängigen Codes strukturell zurück. Der PCI-Bus ist beispielsweise sowohl auf der Intel- als auch auf der Alpha PC-Plattform verfügbar. Auch weitere Hersteller unterstützten diesen Prozeß.
Daß der Anteil des architekturabhängigen Codes in der Realität doch noch beherrschend ist (siehe Tabelle 1), liegt an der großen Vielfalt der von Linux unterstützen Geräte, Karten und sonstiger Peripherie.
Somit sind große Teile der Gerätetreiber, die für die I/O-Anforderungen des Betriebssystems zuständig sind, zumindest teilweise von der Zielplattform abhängig. Dies gilt u.a. für die Festplattencontroller oder ältere Netzwerk- und Soundkarten.
Der Zugriff auf die Basisdienste der Hostplattform wie Registerzugriffe oder Interrupt-Aktivierungen ist auch zumeist architekturspezifisch und wird aus Performancegründen in Assembler ausgeführt.
Sich den Linux-Kern als einfaches Programm vorzustellen fällt schwer, da er aus Benutzersicht ,,quasi immer`` läuft. Gibt es ein main() des Kernes? Das kommt drauf an...
...wo man anfängt zu suchen: Nach dem Einschalten des Rechners wird zunächst ein Bootprogramm gestartet, das je nach Plattform ein wenig unterschiedlich ausgelegt ist: In einem Alpha PC kann dieser Code in einem Flash-RAM gespeichert und auch ausgetauscht werden, bei einem Intel-Rechner ist das sog. BIOS üblicherweise fest als EPROM auf dem Motherboard. Nach einigen Hardwaretests wird dann versucht, von einer ausgezeichneten Stelle wie z.B. einer Diskette, einer Festplatte oder über das Netz einen sog. Bootloader zu laden und zu starten. Dieser heißt bei der Intel-Architektur LILO oder GRUB, beim Alpha PC MILO, der Sparc SILO usw. Über diesen Bootloader kann man einen von mehreren Kernen auswählen, der daraufhin wiederum geladen und gestartet wird.
Abbildung 2:
Bootprozeß von Linux
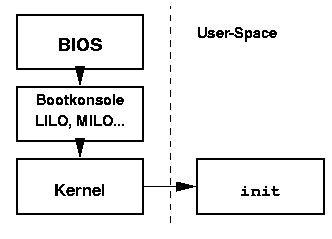
Betrachten wir im weiteren die Geschehnisse bei der Intel-Architektur; ähnliches passiert auch bei den anderen Plattformen [9]. Zunächst muß die Hardware initalisiert werden, der sog. Proctected Mode muß aktiviert werden und viele weitere schmutzige Dinge, die als Assemblercode im Verzeichnis arch/i386/kernel stehen. Schließlich erreichen wir die Datei head.S und rufen ab dort die erste C-Routine auf: Die Funktion start_kernel() ist in der Datei init/main.c zu finden. Sie hat sozusagen die Rolle, die main() in einem Anwendungsprogramm hat.
Dort bereiten wir zunächst einmal eventuelle weitere CPUs auf den Start vor, dann wird das architekturabhängige Setup ausgeführt. Die nun gestarteten Subsysteme brauchen natürlich alle Platz im Speicher, deshalb kann sich jedes Subsystem einen Teil davon reservieren:
setup_arch(&command_line, &memory_start, &memory_end); memory_start = paging_init(memory_start,memory_end);
Im folgenden werden die Speicherverwaltung und die Interrupttabellen initialisiert, Vorbereitungen für die ersten Prozesse getroffen und schließlich die Modulschnittstelle aktiviert.
Dem Kern können genau wie ein einem Benutzerprogramm Argumente übergeben werden, üblicherweise bei der Ausführung des Bootloaders. Diese Argumente werden nun ausgewertet und aktivieren damit ggf. spezielle Setup-Routinen für diesen Parameter:
#ifdef CONFIG_BLK_DEV_FD
{ "floppy=", floppy_setup },
#endif
Falls z.B. der Parameter floppy=one_fdc,cmos bei LILO im Boot-Prompt angegeben wurde, so wird nun die Funktion floppy_setup() (in der Datei drivers/block/floppy.c) mit den entsprechenden Parametern aufgerufen. Die Funktion muß sich dann selbst um das Parsen der Argumente kümmern.
Schließlich werden noch einige Subsysteme initialisiert, die der Kern selbst verwaltet und die immer präsent sind. Dazu gehören die Konsole, ggf. die PCI-Hardware, der dynamische Speicher innerhalb des Kernes, Datenstrukturen für die Dateisysteme und die Interprozeßkommunikation.
Bis hierhin waren keine Interrupts erlaubt und die CPU hat nur diesen einen ,,Kontrollfluß`` verfolgt. Da nun alle notwendigen Vorkehrungen getroffen sind, kann nun der Multitaskingbetrieb aktiviert werden. Als erstes wird ein neuer Prozeß erzeugt und auch von Hand gestartet. Dieser hat die Prozeß-ID 1 und wird auch init-Prozeß genannt [2].
Um keine Verwirrung aufkommen zu lassen: der Kontrollfluß, der den init-Prozeß gestartet hat, läuft weiter (unter der Prozeß-ID 0), allerdings fristet er ein eher trauriges Dasein in der der Funktion cpu_idle():
/*
* Uniprocessor idle thread
*/
int cpu_idle(void *unused)
{
for(;;)
idle();
}
Der Grund dafür ist, daß der init-Prozeß als ,,normaler`` Benutzerprozeß theoretisch auch terminieren kann und daß dann der Kern bzw. in diesem Fall der Dispatcher nicht mehr wüßte, wohin mit den aktuellen CPU-Cycles. Weiterhin kann es vorkommen, daß der init-Prozeß als einziger Benutzer-Prozeß keine Anforderung an die CPU macht, so daß auch in diesem Fall von einer Instanz die CPU ,,konsumiert`` werden muß. Dies erledigt der Idle-Task.
Nachdem wir dem Start des Betriebssystems besondere Aufmerksamkeit gewidmet haben, wenden wir uns nun dem Linux-Kern aus einem ganz anderen Blickwinkel zu, nämlich dem des Benutzerprogrammes: Zu welchem Zweck sollte sich ein Benutzerprogramm überhaupt an den Kern wenden? Kann es nicht einfach alle Aufgaben selbst erledigen? Es muß doch nur der Code ausgeführt werden, der sonst eben im Kern stattfindet -- und das sollte schließlich kein Problem sein, könnte man argumentieren.
Da Unix im allgemeinen ein Mehrbenutzerbetriebsystem ist (,,multiuser``), müssen gewisse Resourcen von mehreren Benutzern geteilt werden, was bedeutet, daß es eine gewisse Reglementierung gibt, wer auf was zugreifen darf und wer nicht. Wohin das Weglassen einer solchen Überlegung führt, ist bestens aus einem (witzigerweise) weit verbreiteten anderen Betriebssystem bekannt.
Diesen Zugriffsschutz erreicht Linux dadurch, daß Zugriffe auf bestimmte Resourcen (z.B. gewisse Speicherbereiche, Interrupts oder I/O-Geräte) nur aus einem privilegierten Zustand heraus durchgeführt werden dürfen. Diesen privilegierte Zustand nennt man Kern-Modus (Kernel-Space), den unprivilegierten Zustand Benutzer-Modus (User-Space).
In den Kernel-Space gelangt man aus Sicht eines Programmierers durch den Aufruf einer Systemfunktion. Oftmals ist gar nicht so einfach ersichtlich, ob eine aufgerufene Funktion tatsächlich ein Systemaufruf ist oder eine Library-Funktion, die komplett oder teilweise im User-Space abläuft. Hier kann das Kommando man weiterhelfen: Im Abschnitt 2 sind Systemaufrufe (z.B. open(2)), im Abschnitt 3 Libraryfunktionen (z.B. printf(3)) aufgeführt. Es gibt in der Version 2.0.33 laut include/asm/unistd.h 164 Systemaufrufe.
Geht man den Dingen noch genauer auf den Grund, so stellt man fest, daß beispielsweise auch open(2) eine Libraryfunktion ist, die allerdings nicht viel mehr macht, als das Makro _syscall1 mit entsprechenden Werten aus obiger Datei auszuführen. Das Makro wiederum expandiert zu einigen Zeilen Inline-Assembler, welche die Parameter und die Nummer des Aufrufes in geeignete Register legen und dann den Software-Interrupt 0x80 auslösen, einen sogenannten Trap (Details finden sich in [3]).
Durch den Interrupt wird der Programmfluß des Prozesses User-Modus gestoppt, der Prozessor schaltet in den privilegierten Modus um und der Kontrollfluß befindet sich somit im Kern. Nach dem Retten der Übergabewerte des Traps aus den jeweiligen Registern springt der Kern in die entsprechende Routine, die den Systemaufruf bearbeitet. All dies geschieht in Assembler in der Datei arch/i386/kernel/entry.S (siehe auch [1]).
Nach Abarbeiten der angeforderten Aufgabe unter Kern-Privilegien legt die Routine ihre Rückgabewert wieder in einem ausgezeichneten Register ab und kehrt nach einigen Administrationsaufgaben wieder in den User-Mode zurück.
Im vorangegangenen Kapitel wurde der explizite Eintritt in den Kern beschrieben. Ein gewisses Problem stellt die Parameterübergabe beim Eintritt dar: zum einen können nur wenige Werte als Argumente übergeben werden, da sie in Registern zwischengespeichert werden und zum anderen weist jeder Systemaufruf seinen Argumenten eine von den anderen Aufrufen völlig unabhängige Semantik zu.
Von diesen Überlegungen ausgehend wurde bei der Entwicklung von Unix ein Paradigma geschaffen, das durch seine Universalität entscheidend zu dessen Erfolg beigetragen hat und das heute auch in vielen anderen Betriebssystemen Einzug gehalten hat: Auf (fast) alle Systemresourcen (hauptsächlich I/O-Geräte) kann über das Dateisystem zugegriffen werden. Dadurch können die Geräte durch einen fest umrissenen Satz von Systemfunktionen (open(), read(), write(), close() und Verwandte) erreicht werden, ohne für jeden neuen Service eine neue Systemfunktion einzuführen.
Der Virtual Filesystem Switch (VFS) von Linux denkt die Idee der Vereinheitlichung des Zugriffes auf User-Seite noch einen Schritt auf Kernel-Seite weiter: Auch hier gibt es eine einheitliche Schnittstelle, die beschreibt, was ein Filesystem können muß. Diese Schnittstellen benutzend, baut der VFS den kompletten Dateibaum auf, indem er die einzelnen Teile verbindet. Somit ist die Funktionalität des Mountens von verschiedenen Festplattenpartitionen je nach Blickwinkel sozusagen ein ,,Abfallprodukt`` des VFS, der sich selbst nur noch mit den allgemeinen Aufgaben wie dem (abstrakten) Traversieren im Dateibaum oder der Verwaltung der Inodes kümmern muß, die ihm die einzelnen Filesysteme liefern.
Der Kern verwaltet eine Liste der von ihm bekannten Filesysteme, die über die Variable file_systems zugreifbar ist (siehe Abbildung 3). Im wesentlichen wird hier der Name des Subsystems und die super_block-Struktur verwaltet, die u.a. eine Reihe von Funktionen enthält, die das jeweilige Filesystem eben realisieren muß (siehe Abbildung 4).
Abbildung 3: Definition eines Filesystems aus include/linux/fs.h
struct file_system_type {
struct super_block *(*read_super) (struct super_block *, void *, int);
const char *name;
int requires_dev;
struct file_system_type * next;
};
Abbildung 4: Zu implementierende Funktionen eines Filesystems aus include/linux/fs.h
struct super_operations {
void (*read_inode) (struct inode *);
int (*notify_change) (struct inode *, struct iattr *);
void (*write_inode) (struct inode *);
void (*put_inode) (struct inode *);
void (*put_super) (struct super_block *);
void (*write_super) (struct super_block *);
void (*statfs) (struct super_block *, struct statfs *, int);
int (*remount_fs) (struct super_block *, int *, char *);
};
Auf diese Weise können so unterschiedliche Funktionalitäten wie das Ext2-Filesystem für Festplatten, NFS für Netzwerkzugriffe oder das /proc-Filesystem als Sichtfenster in den Kernel über dieselbe Schnittstelle realisiert werden. Zur Zeit gibt es knapp 20 Filesystemimplementationen für Linux.
Zu den einzelnen Dateien kommt man nun über die Inodes, die ausgehend vom Superblock aus verwaltet werden, z.B. durch ein sequentielles Durchlaufen, begonnen bei super->s_mounted oder durch den Rückgabewert der Funktion namei(), die die passende Inode zu einem Pfadnamen heraussucht.
Will man etwas mit der Datei tun (nicht mit ihrem Inhalt), also sie z.B. überhaupt einmal erzeugen, die Rechte ändern oder Verzeichnisse durchlaufen oder ändern, so kann man auf die in der Struktur inode_operations definierten Funktionen zurückgreifen. Somit repräsentiert die Inode sozusagen die benutzerabgewandte Seite einer Datei, die auf dem Massenspeicher oder wo immer liegt.
Aus Benutzersicht kommend interessiert uns zumeist mehr die benutzerzugewandte Seite einer Datei. Haben wir erst einmal einen open()-Systemaufruf auf eine Datei (aus Benutzersicht repräsentiert durch ihren Pfadnamen) ausgeführt, führen wir nur noch die in der file-Struktur definierten file_operations aus. Diese sind letztlich als einzige durch Systemaufrufe vom User-Space aus durch geeignete Wrapper zugänglich.
Betrachten wir nun abschließend in Abbildung 5 einmal den Weg, den wir beim Öffnen einer beliebigen Datei nehmen (man bedenke, daß dies sowohl eine Datei auf der Festplatte, ein Device-File oder eine Datei auf einem entfernten Rechner sein kann).
open() |
Aufruf des Library-Wrappers für den Systemaufruf |
_syscall1 (__NR_open, ...) |
Umsetzung durch die Standard-Library in ein Makro |
int $0x80,05,... |
Erzeugter Assembler-Code zum Auslösen eines Traps |
call sys_call_ table[__NR_open] |
Traphandler in entry.S, der zu den einzelnen
Systemaufrufen verzweigt... |
sys_open() |
...nämlich in die tatsächliche Systemfunktion für
open() in fs/open.c. Dort wird nur ein
Filedeskriptor besorgt und das Argument in den Kernel-Space
übertragen. |
do_open() |
Die eigentliche Arbeit passiert hier: nachdem die passende Inode
geholt wurde, geschehen hier diverse Zugriffsüberprüfungen und
Verwaltungsarbeiten, damit der neu erzeugte Filepointer
(file) richtig initialisiert wird. |
open_namei() |
Holt sich die passende Inode zu dem per Systemaufruf übergebenen
Pfadnamen (zu finden in fs/namei.c). Dazu bedient sie
sich u.a. |
dir_namei() |
das ausgehend von dem (prozeßspezifischen) Root-Inode das passende Verzeichnis sucht. |
Jetzt erst rollt sich der komplette Aufrufstack wieder von hinten auf, die gefundene Inode wird in der Filepointer-Struktur aufbewahrt, wenn mit einem zukünftigen read() oder write() Systemaufruf auf sie zugegriffen wird. Dabei werden auch die zu der Inode gehörenden file_operations in den Filepointer geschrieben.
Mit den nun erworbenen Kenntnissen ist überschaubar, was nötig ist, um einen eigenen Device-Treiber für ein noch nicht unterstütztes Gerät zu schreiben. Grob kann man den Entwurf in zwei Teilbereiche aufteilen:
Der erste Punkt ist natürlich sehr stark durch das angeschlossene Device bestimmt und läßt sich schlecht verallgemeinern. Im wesentlichen muß hier zunächst die Hardware erkannt und initialisiert werden, um später auf I/O-Ports oder auf in den Speicher eingeblendete Register zuzugreifen. Dieser Teil ist naturgemäß sehr plattformspezifisch und somit nur eingeschränkt portabel, weshalb wir uns hier nicht weiter damit befassen wollen. Einige anschauliche Realiserungen sind in [12] (Schrittmotorsteuerung), [6] (Ansteuerung einer DSP-Karte) und [1] (PC-Speaker) beschrieben. Letzteres beschreibt genau wie [8] die zugrundeliegenden Verfahren recht ausführlich.
Die Realisierung der Aufrufschnittstelle gestaltet sich hingegen mit den bislang erworbenen Erkenntnissen recht einfach: Wir müssen nur noch die im letzten Abschnitt erwähnten file_operations realiseren und dem Kern mitteilen, daß wir nun diesen Service auch anbieten.
Da es verschiedene grundlegende Arten des Zugriffs auf Geräte gibt, hat man sie in die Klassen zeichenorientierter und blockorientierter Devices-Zugriff eingeteilt. Blockorietierte Geräte unterstützen die direkte Übertragung von ganzen Datenblöcken am Stück und nutzen dazu oft auch spezielle Hardware, insbesondere Direct Memory Access (DMA), wobei diese Blöcke ohne Belastung der CPU z.B. von der Festplatte in den Hauptspeicher übertragen werden können. Dieser sehr effiziente Datenzugriff hat dadurch jedoch auch seine Tücken und soll hier nicht weiter im Detail betrachtet werden.
Bei den Character-Devices kann man sich die erwartete Funktionalität der in Abbildung 6 aufgeführten file_operations leicht vorstellen; nicht benötigte Funktionalität wird einfach in dem Funktionsvektor mit einem NULL-Pointer ausgeschaltet, so daß sich der VFS um eine geeignete Handhabung kümmert.
Abbildung 6: Zu implementierende Datei-Operationen aus include/linux/fs.h
struct file_operations {
int (*lseek) (struct inode *, struct file *, off_t, int);
int (*read) (struct inode *, struct file *, char *, int);
int (*write) (struct inode *, struct file *, const char *, int);
int (*readdir) (struct inode *, struct file *, void *, filldir_t);
int (*select) (struct inode *, struct file *, int, select_table *);
int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, unsigned int, unsigned long);
int (*mmap) (struct inode *, struct file *, struct vm_area_struct *);
int (*open) (struct inode *, struct file *);
void (*release) (struct inode *, struct file *);
int (*fsync) (struct inode *, struct file *);
int (*fasync) (struct inode *, struct file *, int);
int (*check_media_change) (kdev_t dev);
int (*revalidate) (kdev_t dev);
};
Wenn man sich nun die in Abbildung 5 beschriebene Vorgehensweise vor Augen hält, wird klar, daß jetzt nur noch die Zuordnung von den einzelnen Inodes zu einem passenden Satz file_operations geschehen muß. Dies wird durch die sog. Major- und Minor-Numbers, die in der Inode durch einen mknod()-Systemaufruf eingetragen werden realisiert: Um zu gewährleisten, daß ein Gerätetreiber für die entsprechende Major-Number existiert, muß sich jedes Subsystem im Kernel mit der Funktion register_chrdev() unter der Angabe der gewünschten Major-Number und einem Subsystemnamen anmelden. Dies geschieht entweder für fest in den Kernel eincompilierte Treiber in der in Kapitel 3 beschriebenen Initialisierungsphase oder in der später beschriebenen Initialiserung des jeweiligen Modules. In diesem Fall steht eben noch eine zugehörige Funktion zum Entfernen des Moduls an.
Damit ist unser einfacher Gerätetreiber bereits fertig. Ein leichtverständliches Grundgerüst für einen simplen Treiber wird in [4] beschrieben.
In der Forschung haben sich zwei Grundtypen von Betriebssystemkernen herausgebildet [11]: Microkernelbasierte und sog. monolithische Kerne. Wenn auch Microkernels im allgemeinen als technologisch eleganter angesehen werden, da in ihnen grundsätzlich eine klarere Strukturierung und Verteilung der Implementation möglich ist, dominieren letztlich die monolithischen Systeme, da sie oftmals effizienter sind. Dies gipfelte in der berühmten Aussage des als Betriebssystem-Guru angesehen Prof. Andrew S. Tanenbaum: ,,Linux is obsolete``. Inwiefern dies zutrifft, mag jeder selbst entscheiden.
Ein Microkernel realisert nur sehr wenige Grundfunktionen im privilegierten Modus und deligiert viele Dinge inklusive der dazu benötigten Berechtigungen an Prozesse, die im User-Modus laufen und realisert so ein Client-Server-Modell. So kann die Datei- oder Speicherverwaltung komplett in einem eigenen Prozess ablaufen. Dies ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Strukturierung interessant.
Ein monolithisches System realisert dagegen alle Funktionalität direkt im Kern. Da dort bereits die notwendigen Berechtigungen zum Zugriff auf die Hardware etc. vorliegen, ist ein solches System oftmals effizienter. Linux hat diesen Weg eingeschlagen.
Das Hauptproblem der monolithischen Strukturen liegt in der Tatsache, daß man leicht den Überblick verlieren kann: Wie anfangs schon erwähnt, besteht der komplette Kern aus einer dreiviertel Million Zeilen an Code. Dieses Manko macht Linux durch sein ausgereiftes Modul-Konzept wieder wett: In sich geschlossene Teile des Kerns, die nicht immer oder nicht in jeder Konfiguration benötigt werden, werden als separate Module ausgeführt und erst bei Bedarf zum Kern hinzugefügt.
Dies kann sogar während der Laufzeit geschehen: Wenn z.B. auf einen Gerätetreiber oder ein Filesystem zugegriffen wird, das sich nicht im Kern befindet, so kann über den sog. kerneld das entsprechende Modul nachgeladen und bei Bedarf wieder entfernt werden.
Für den Entwickler von Kernel-Code ist dies außerdem eine ernorme Erleichterung, da er nicht bei jeder minimalen Änderung einen komplett neuen Kern bauen und neu starten muß.
Es bleibt festzustellen, daß das Architekturmodell von Linux mit seinen Modulen zwar sehr flexibel ist, jedoch Linux damit immer noch kein Microkernel-System ist.
Zunächst stellt sich einmal die Frage, was überhaupt als Modul realisierbar ist: Diese Subsysteme, die in sich relativ abgeschlossen sind, kann man als Faustregel gut daran erkennen, daß sie einen eigenen Namen besitzen. Dies sind im wesentlichen:
Wird ein bestimmter Service von einem Subsystem angefordert, das gegenwärtig nicht vorhanden ist, so wird ggf. über eine Messagequeue von dem als User-Prozeß laufenden kerneld das Nachladen des entsprechenden Moduls angefordert, was mit dem Systemaufruf create_module() durch ein Einladen des Codes in den User-Adreßraum und einer anschließenden Relokation des Modul-Codes realisiert wird. Der nachfolgende Systemaufruf init_module() kopiert diesen Code dann in das Kernel-Segment und aktiviert dort eine gleichnamige Funktion, die daraufhin die angebotenen Dienste beim Kernel registrieren läßt, so daß die ursprüngliche Anfrage nun bearbeitet werden kann.
Das Modul selbst verwaltet einen Referenzzähler, so daß das Modul u.U. sogar auf eine vom kerneld initiierte Anfrage delete_module() hin wieder entfernt werden kann.
Als weitere Schnittstellen muß das Modul ,,nur noch`` die von ihm angebotenen Dienste bereitstellen und diese implementieren.
Einen Prozeß kann man unter Unix in erster Näherung als Abstraktion des Betriebsmittels CPU ansehen: Er läßt in seinem eigenen Adreßraum von anderen Prozessen unabhängig ein eigenes Programm ablaufen, ohne daß es zu Überschneidungen mit anderen Prozessen kommt, solange diese voneinander unabhängig bleiben.
Da das Prozeßmanagement mit der Realisierung des Multitaskings ein sehr zentrales Konzept innerhalb des Kerns darstellt, können hier nur Einzelaspekte beleuchtet werden. Eine Diskussion der Mechanismen findet man in [11], die Realiserung für Linux ist in [1] beschrieben.
Alle relevanten Informationen eines Prozesses sind über eine einzige Datenstruktur zugreifbar: Die task_struct-Struktur enthält Angaben zu
Die beschriebene Struktur ist in der Datei include/linux/sched.h definiert. Innerhalb des Kernels kann über die Variable current jederzeit auf den aktuell laufenden Prozeß zugegriffen werden, die ein Zeiger auf die Prozeßtabelle task4 Über die oben beschriebenen Prozeßrelationen sind die einzelnen Prozesse auf vielfältige Weise miteinander verpointert.
Die Prozeßerzeugung verdient gerade unter Linux ein wenig besondere Aufmerksamkeit, da ihre effiziente Umsetzung schon in sehr frühen Kernelreleases Anerkennung erhalten hat. Um unter Unix einen neuen Prozeß zu erzeugen geht man üblicherweise wie folgt vor: Zunächst wird eine fast identische Kopie des erzeugenden Prozesses durch den Systemaufruf fork() erzeugt, die sich nur durch die Prozeß-ID und die entsprechenden Prozeßrelationen von ihrem Vater unterscheidet. Insbesondere werden der Adreßraum und alle Filedeskriptor-Einträge dabei kopiert, was eine vergleichsweise teure Operation darstellt, weil viel Speicher kopiert werden muß. Dies ist insbesondere dann ,,tragisch``, wenn der so kopierte Adreßraum durch einen sich direkt anschließenden Systemaufruf der exec()-Familie erneut überschrieben wird.
Um dieses Problem zu umgehen, wurde bei dem Entwurf von Linux konsequent das Copy-On-Write-Prinzip angewandt, welches bei einem fork() eben nicht den kompletten Adreßraum kopiert, sondern die Seitentabellen des Vaterprozesses weiterhin mit diesem zusammen nutzt. Jedoch sind nun für beide Nutzer die beteiligten Speicherkacheln als read-only markiert, was bei einem Schreibzugriff zu einem Seitenfehler führt. Die Speicherverwaltung erkennt den Grund für diesen Konflikt, kopiert die zugegriffene Seite (im Gegensatz zum kompletten Adreßraum) und führt die Änderung dann entsprechend aus. Zusammen mit den leistungsfähigen Block-Buffern, in denen Linux einzelne Blöcke des dynamischen Speichers vorhält, ist dies eine ungewöhnlich leistungsstarke Implementation.
Als Nebenprodukt von fork() ist der durch minimale nur Änderungen entstandene Bruder-Systemaufruf clone(), der die prinzipielle Nutzung von sog. Kernel-Level-Threads ermöglicht. Der eigentliche Unterschied zwischen fork() und clone() ist nämlich nur, daß beide neu erzeugten Prozesse tatsächlich in ein und demselben Adreßraum ablaufen. Dies birgt natürlich einige Gefahren, da ein Thread den anderen beeinflussen kann, jedoch oft ist genau dies beabsichtigt: Die Nutzung von Shared Memory ist die performanteste Form der Interprozeßkommunikation -- leider jedoch auch eine der fehlerträchtigsten. In [3] wird ein interessanter Ansatz geschildert, wie man sich dieses Feature des Kernels in geeigneter Weise im User-Space nutzbar machen kann.
Durch die stetige und konsequente Weiterentwicklung realisiert der Linux-Kernel heute im wesentlichen die State-of-the-Art Prinzipien der Betriebssystementwicklung. Durch den freien Source-Code und die Virtualisierung von vielen Konzepten ist eine produktive parallele Entwicklung von neuen Features und Unterstützung von einer breiten Palette an Hardware erst möglich.
In diesem Artikel wurde dargelegt, daß durch die vorliegende Strukturierung der Sourcen recht einfach ein informelles Verständnis von den Vorgängen und Zusammenhängen im Kern erlangt werden kann. Es soll jedoch auch nicht verschwiegen werden, daß die ingenieursmäßige Entwicklung und Erprobung von ,,Real-World``-Implementationen harte Arbeit und mit vielen Detailproblemen behaftet ist, und somit einer weiteren Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet bedarf.
Einen Gegenpol verschafft er sich durch die Analyse und Synthese innovativer zeitgenössischer Musik, gelegentliche Reisen in die Welt sowie durch seine Kurzromane. Nils Magnus lebt in Kaiserslautern und ist Hamster-Fan.